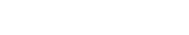Einst galt Marko Marin als große deutsche Fußballhoffnung. Als damals 21-Jähriger bestritt er sogar zwei Partien für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika und in dieser Zeit brillierte er in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, wo er mit Mesut Özil ein kongeniales Duo bildete. Doch ein Wechsel zum FC Chelsea brachte für Marko Marin den großen Karriereknick. 2012 unterschrieb der Flügelflitzer beim Premier-League-Klub, doch es folgte eine Odyssee durch Europas Ligen. Seit 2018 steht Marko Marin bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag und beim serbischen Hauptstadtklub scheint der inzwischen 30-Jährige sein Glück gefunden zu haben. Am Mittwoch führt Marko Marin in der Champions League Roter Stern Belgrad als Kapitän auf den Rasen der Münchner Allianz Arena und dann steht der 1,70 m große Mittelfeldspieler wieder in Deutschland im Fokus.
Marko Marin kann sich eine Bundesligarückkehr vorstellen
Insgesamt vier Jahre war Marko Marin beim FC Chelsea angestellt, doch für die Blues bestritt er nur sechs Spiele. Stattdessen wurde Marko Marin immer wieder verliehen. In der Saison 2013/14 kickte er für den FC Sevilla, danach folgte eine Leihe zum AC Florenz und anschließend war der Mittelfeldmann Leihspieler für RSC Anderlecht und Trabzonspor.
2016 gingen Marko Marin und der FC Chelsea schließlich getrennte Wege. Marko Marin unterschrieb beim griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus, wo er in zwei Jahren 37 Partien bestritt und dabei elf Tore erzielte und auch griechischer Meister wurde.
Dann rief Roter Stern Belgrad und ein Wechsel zum serbischen Serienmeister machte für Marko Marin Sinn, weil seine Eltern serbischstämmig sind. Marko Marin selbst wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren, allerdings in einem Teil, das heute zu Bosnien und Herzegowina gehört. Als Marko Marin zwei Jahre alt war, wanderten seine Eltern nach Deutschland aus und der fußballbegeisterte Marko Marin landete schließlich in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt. Dort spielte er von seinem 7. Lebensjahr an, bis Borussia Mönchengladbach 2005 auf den damals 16-Jährigen aufmerksam wurde. Bei den Fohlen schaffte Marko Marin auch den Durchbruch in der Bundesliga. Besonders als Vorlagengeber tat sich der Flügelflitzer hervor.
Nun ist der 30-Jährige bei Roter Stern Belgrad ein Führungsspieler, doch eine Rückkehr in die Bundesliga ist nicht ausgeschlossen. Am Liebsten würde Serbiens Fußballer des Jahres noch einmal für Eintracht Frankfurt auflaufen, doch erst einmal steht die Champions League an. Dort trifft Roter Stern Belgrad in der Vorrunde auf Tottenham, Olympiakos Piräus und die Bayern
Ein Münchner Trauma
Der deutsche Rekordmeister hat gegen Roter Stern Belgrad 1991 eine der bittersten Niederlagen der Vereinsgeschichte erlebt. Knapp ein Jahr zuvor hatte der damalige Bayerntrainer Jupp Heynckes auf dem Münchner Rathausbalkon feierlich „Und nächstes Jahr holen wir den Europacup“ erklärt. Dieser Satz schwebte in der darauffolgenden Saison wie ein Damoklesschwert über den Bayern. Doch die Münchner schafften es bis ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister. Dort wartete Roter Stern Belgrad, das damals mit Spitzenspielern wie Robert Prosinecki gespickt war. Nach einer 1:2-Heimniederlage drehten die Bayern im Rückspiel den Spieß herum und lagen kurz vor Schluss im Hexenkessel von Belgrad 2:1 vorne. Doch dann verschätzte sich Bayernkeeper Raimond Aumann bei einem missglückten Abwehrversuch von Klaus Augenthaler und es stand auf einmal 2:2, was das Weiterkommen für Roter Stern Belgrad bedeutete.
Diese Erfahrung möchten die Serben mit in die Allianz Arena nehmen. Und Marko Marin soll ein wichtiger Baustein werden, dass den Belgradern noch einmal solch ein Coup gelingt.